Der Banken-Raubzug der italienischen Regierung
TiAM FundResearch blickt auf die vergangene Woche zurück und gibt einen Ausblick auf die kommenden Tage. Diesmal im Fokus: Was der italienische Coup über das Wirtschaftsverständnis von Populisten verrät.
14.08.2023 | 07:30 Uhr
Rückblick auf die vergangene Woche
Mit wieviel wirtschaftlichem Sachverstand Neo-Faschisten regieren, lässt sich derzeit gut in Italien beobachten. Dort haben Regierungschefin Giorgia Meloni und Vizeregierungschef Matteo Salvini am vergangenen Montag überraschend eine Steuer auf sogenannte Übergewinne von Banken angekündigt. Das Kabinett in Rom stimmte für eine 40-prozentige Abgabe. Besteuert werden sollten die Zinsgewinne der Banken im Jahr 2022, wenn sie drei Prozent über denen des Jahres 2021 liegen, oder des Jahres 2023, wenn sie sechs Prozent über denen des Jahres 2022 liegen. Nachdem die Aktienkurse italienischer Banken daraufhin massiv eingebrochen waren, teilte das Finanzministerium am Dienstagabend schließlich mit, die Einnahmen aus der Sondersteuer würden 0,1 Prozent der Bilanzsumme der Finanzinstitute nicht überschreiten. Das sorgte zwar für Erleichterung in der Finanzindustrie. Doch es bleibt ein schaler Nachgeschmack. Denn die Maßnahme zeugt davon, wie willkürlich Populisten agieren, wenn es ihren persönlichen Zielen und der Erhaltung ihrer Macht dient.
Wie fern von jeglichem volkswirtschaftlichen Sinn oder gar einer Art von "Gerechtigkeit", die die Populisten reklamieren, der Vorstoß der italienischen Regierung ist, lässt sich schnell belegen: Meloni und Salvini begründen ihren Vorstoß damit, dass die italienischen Banken „milliardenschwere Übergewinne“ einfahren würden, während für Privathaushalte und Unternehmen die Kosten für Kredite stiegen. Korrekt ist: Italiens Banken haben in den vergangenen Jahren der Nullzinspolitik der EZB an der Grenze der Wirtschaftlichkeit gearbeitet. Die Bilanzen sind mit italienischen Staatsanleihen vollgestopft. In der Coronakrise hat sich das noch einmal verstärkt. Zum Ende des Jahres 2021 machten italienische Staatsanleihen das 1,2-fache des Eigenkapitals der Banken in Italien aus. Nur so konnte Italien die Krise überstehen.
Als die EZB im vergangenen Jahr anfing, im Eiltempo die Leitzinsen zu erhöhen, hätte sie damit ein Bankenbeben in Italien auslösen können. Denn die mit einem Absacken der Anleihekurse in den Bankendepots wäre das Eigenkapital der Kreditinstitute geschrumpft. Damit wäre zugleich ihre Handlungsfähigkeit empfindlich gestört worden. Um es vorsichtig auszudrücken. Dass das Kartenhaus nicht zusammenfiel, hat damit zu tun, dass die Europäische Zentralbank ihr auslaufendes Staatsanleihe-Aufkaufprogramm „auf jene Staaten konzentrierte, deren Risiko-Spreads besonders unter Druck gerieten“. Jeder wusste, dass damit Italien gemeint war. Mit anderen Worten: Die italienischen Banken haben in den vergangenen Jahren dem italienischen Staat den Allerwertesten gerettet. Und die EZB hat dafür gesorgt, dass das überhaupt möglich war. Dass die Banken in Italien in den vergangenen 18 Monaten dank gestiegener Zinsen wieder bessere Geschäfte machen konnten, hätte Salvini und Meloni deshalb eigentlich freuen können. Noch immer schlummern neben niedrig verzinsten Italo-Anleihen auch milliardenhohe faule Kredite in den Büchern der italienischen Banken. Die Rekordeinnahmen der vergangenen Monate können die Finanzinstitute gut gebrauchen, um ihre Bilanzen endlich erfolgreich zu sanieren, um eine immer noch drohende Bankenkrise zu vermeiden. Das aber wollen ihnen die Populisten in der Regierung offensichtlich nicht gönnen. Geht es darum, beeindruckende Schlagzeilen zu machen, ist ihnen jede noch so abstruse Maßnahme willkommen.
Brosamen fürs Volk, Köstlichkeiten für die Elite
Mit der Übergewinnsteuer spielt Matteo Salvini den Robin Hood fürs Fußvolk. Diejenigen, die ihm die Rolle ernsthaft abnehmen, haben leider nichts verstanden. Denn von den Einnahmen werden nicht die Armen und Geschundenen profitieren, denen die Regierung vor Kurzem per SMS die Sozialhilfe gestrichen hat, sondern Immobilienbesitzer und Unternehmer. Falls überhaupt. Das Geld soll in einem Sonderfonds gesammelt und dann verteilt werden. Wie das genau geschehen soll, ist noch offen, und den Fonds gibt es natürlich auch noch nicht. Und ob der überhaupt Sinn macht, ist zweifelhaft. Experten haben ausgerechnet, dass mit der Übergewinnsteuer gerade einmal rund zwei bis drei Milliarden Euro zusammenkommen könnten. Peanuts. Wenn die Finanzbehörden das überhaupt hinbekommen.
Italiens Steuereintreiber sind traditionell überfordert mit ihren Aufgaben. Ihre Arbeit wurde zuletzt auch nicht erleichtert: Die ultrarechte Regierung unter Meloni hat im November 2022 eine Maßnahme mit dem Namen „tregua fiscale“ beschlossen. Das bedeutet so viel wie „fiskalischer Waffenstillstand“. Im Rahmen dieser Steueramnestie wurden Italiens Bürgern sämtliche Steuerschulden, die 1.000 Euro nicht überstiegen und aus den Jahren vor 2015 stammen, erlassen. Einfach so, ohne Sanktionen und ohne die Erhebung von Verzugszinsen. Laut italienischem Finanzministerium war bis zu dem Erlass fast jeder zweite Steuerpflichtige im Verzug mit seinen Zahlungen. Die ausstehenden Steuerschulden beliefen sich auf insgesamt 1,132 Milliarden Euro. Die verbleiben nun bei denjenigen, die nicht so dumm waren, ihre Steuern zu bezahlen. Dass die Regierung keinen großen Wert auf Steuerehrlichkeit legt, zeigt auch eine weitere Maßnahme im Rahmen des „tregua fiscale“: Die Obergrenze für Barzahlungen wurde von 1.000 Euro auf 5.000 Euro angehoben. Und die Quittungspflicht für Gewerbetreibende im Einzelhandel ist de facto abgeschafft. Finanzbeamte dürfen ihre Nase nur noch unter hohen Auflagen in die Bücher von Unternehmern stecken. Steuersünder sind schließlich auch Wähler.
Fazit: Der Griff in die Tresore der Banken ist kein Akt der Gerechtigkeit, wie es die italienische Regierung darstellt. Er ist nur ein weiterer Beweis dafür, wie plump Populismus funktioniert. Und wer am Ende die Rechnung für den Unsinn bezahlt. Das sollten sich übrigens auch hierzulande diejenigen vor Augen führen, die der Versuchung unterliegen, Populisten ob ihrer markigen Sprüche zu wählen.
Ausblick auf interessante Termine in dieser Woche
Am Dienstag bleiben in etlichen Staaten rund um den Globus die Banken und Geschäfte zu. Auch in Bayern und im Saarland. Wegen Mariä Himmelfahrt. Da, wo der Katholizismus nicht die Ladenschlusszeiten berührt, geht das Leben normal weiter. Zum Beispiel in der Schweiz. Dort werden am Dienstag aktuelle Zahlen zur Entwicklung der Erzeuger- und Importpreise veröffentlicht. Der Alpenstaat ist in Europa der erste, in dem diese Preise sinken. Also: nicht nur langsamer steigen, sondern tatsächlich sinken. Das hat die Schweiz sicher auch ihrer starken Währung zu verdanken. Gegenüber dem Euro notiert der Schweizer Franken auf Allzeithoch. Merke: Eine starke Währung kann das Leben preiswerter machen.
Am Mittwoch erklärt in Berlin die Deutsche Umwelthilfe (DUH), wie sich durch Gebäudesanierung anstelle von Abriss und Neubau CO2 einsparen lässt. Zeitgleich bittet der Veranstalter des „Caravan-Salons“, der weltweit größten Messe für Reisemobile und Caravans, in Duisburg zum Fototermin und zur Vor-Pressekonferenz. Vielleicht hätte man die beiden Veranstaltungen zusammenlegen sollen. Es hätten sich sicherlich interessante Gesprächsthemen und Synergien ergeben können.
Am Donnerstag verkündet die statistische Behörde Eurostat neue Zahlen zur Entwicklung der Handelsbilanz der Eurozone. Aktuelle Tendenz: Die Menge der Importe gegenüber den Exporten für Güter und Dienstleistungen in die beziehungsweise aus der Eurozone halten sich in etwa die Waage. Mit anderen Worten: Ein positiver Handelsbilanzüberschuss war gestern. Heute gibt Euroland in der Summe ein klein wenig mehr aus als es einnimmt. Und morgen wird man sehen. Vorsichtige Prognose: Auf Italien als neuen europäischen Wachstumsmotor wird man eher nicht zählen können.
Am Freitag gibt Eurostat den aktuellen Stand des Verbraucherpreisindex bekannt. Es könnte sein, dass die Inflation in der Eurozone wieder unter fünf Prozent rutscht. Trotz gestiegener Energiepreise. Das ist immer noch weit entfernt von dem, was traditionell in der Schweiz passiert. Dort gilt eine Inflationsrate von über drei Prozent als ein sehr außergewöhnliches Ding, vergleichbar mit dem Ungeheuer von Loch Ness. Zuletzt wurde das Phänomen vor dreißig Jahren gesichtet. Also die Inflation in der Schweiz. Ob Nessie lebt, klärt sich vielleicht Ende des Monats. Am 26. und 27. August 2023 startet in Loch Ness eine gigantische Suchaktion, die beweisen oder widerlegen soll, dass es das sagenumwobene Monster gibt.

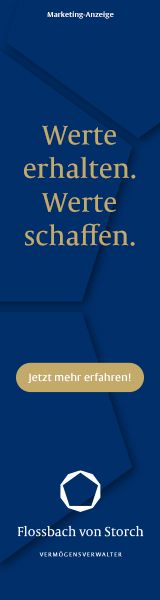
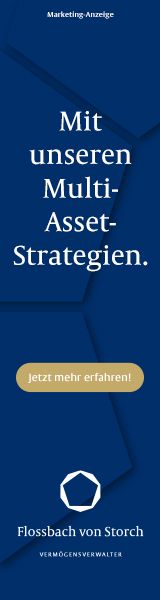




























Diesen Beitrag teilen: