Die Doppelwumms-Bazooka
TiAM FundResearch blickt auf die Woche zurück und gibt einen Ausblick auf die kommenden Tage. Diesmal im Fokus: die neue „Whatever it takes“-Haushaltspolitik.
10.03.2025 | 08:30 Uhr von «Matthias von Arnim»
Rückblick auf die vergangene Woche
Als Journalist Wochenrückblicke zu schreiben, ist derzeit eine besondere Herausforderung. Während man noch tippt, ist garantiert schon wieder irgendetwas passiert, was alles bis dahin Geschehene in den Schatten stellt. Oder komplett über den Haufen wirft.
Ein Beispiel: Eben noch ist eine deutsche Regierungskoalition an der Frage gescheitert, wie man den nächsten Haushalt finanzieren soll. Derjenige, der die Schwierigkeiten durch seine erfolgreiche Verfassungsklage gegen die freizügige Verwendung von Sondervermögen ausgelöst hat, hielt zudem die Schuldenbremse für unantastbar. Bis zu dem Zeitpunkt, da der ukrainische Präsident im Weißen Haus nach allen Regeln der geheimdienstlich-russischen Verhörkunst öffentlich zusammengefaltet wurde. Plötzlich ging auch den letzten transatlantischen Optimisten auf, dass Europa die letzte Insel der Demokratie ist. Ohne US-Verbündete. Und damit ohne ausreichende militärische Fähigkeiten. Das soll sich jetzt schleunigst ändern. Und so hat der sehr wahrscheinlich nächste Bundeskanzler, der eben noch keine neuen Schulden machen wollte, mit seinem sehr wahrscheinlichen neuen Koalitionspartner, der eben noch an der Schuldenbremse gescheitert war, einen Schuldenpakt geschlossen, der – falls dieser durch den Bundestag kommt und vom Bundesrat bestätigt wird – alles sprengt, was bisher so in der Geschichte der Bundesrepublik an Finanzierungsprogrammen beschlossen wurde. (Abgesehen von der Finanzierung der Deutschen Wiedervereinigung. Aber das ist eine andere Geschichte.)
Flankiert wurde die Nachricht, deutsche Rüstungsausgaben künftig nicht mehr zu limitieren und zusätzlich 500 Milliarden Euro für Infrastruktur-Investitionen über ein Sondervermögen zu finanzieren, von der Nachricht aus Brüssel, man wolle 800 Milliarden Euro locker machen für die Aufrüstung Europas. Beides zusammen hört sich nach einer fulminanten Doppelwumms-Bazooka an. Europa rüstet auf, „what ever it takes“.
Die Reaktion der Finanzmärkte auf diese Ankündigungen ließ nicht lange auf sich warten. Schnelle Kopfrechner addierten die im Raum stehenden Kredite, die die Länder der Europäischen Union demnächst am Finanzmarkt aufnehmen müssten, auf Billionensummen hoch. Ihre Schlussfolgerung: Der Rentenmarkt würde demnächst überflutet werden mit französischen italienischen und vor allem (!) deutschen Staatsanleihen. Also stießen Investoren vor allem die Langläufer in ihren Portfolios in großem Umfang ab. Die Renditen zehnjähriger Bundesanleihen stiegen am Montag vergangener Woche von 2,5 auf 2,8 Prozent.
Überzogene Reaktion an den Rentenmärkten
Wie das oft so ist, wenn Angst das Hirn auffrisst, war es ein Kahlschlag auf breiter Front ohne Sinn und Verstand. Um nur ein Beispiel zu nennen: Der Spread zwischen zehnjährigen Bundes- und französischen Staatsanleihen schrumpfte zuletzt auf 0,7 Prozentpunkte – das entspricht im Vergleich zum Jahresanfang einer 20prozentigen Reduzierung der Risikoprämie für französische Schuldpapiere gegenüber Bundesanleihen. Nur einmal zur Einordung: Selbst, wenn Deutschland von heute auf Morgen seinen Schuldenstand um 500 Milliarden Euro in die Höhe schrauben würde, wäre die Bundesrepublik gerade einmal mit 72 Prozent des BIPs verschuldet. Zum Vergleich: Frankreich ist heute schon mit 110 Prozent des eigenen BIPs verschuldet, Italien mit 135 Prozent.
Man fragt sich, was genau die Herde in den Verkaufsmodus getrieben hat. Etwa die vermeintliche Billionensumme? Tatsächlich könnte es so viel werden. Aber nicht morgen in aller Frühe. Und schon gar nicht auf einmal. Und wir reden hier auch nicht von Konsumausgaben, sondern von Investitionen, die einen positiven Effekt auf die Wirtschaft und damit das BIP in Deutschland und anderen europäischen Ländern haben werden – was die Verschuldungsgrade im besten Fall sogar senken könnte.
Der Reihe nach: Die 800 Milliarden Euro, die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ins Spiel gebracht hat, müssen die 27 EU-Staaten natürlich selbst stemmen. Die EU kann schließlich kein Geld drucken, sondern lebt von den Beiträgen ihrer Mitglieder. Was die Kommission leisten kann, ist ein gemeinsamer Sonderfonds – in diesem Fall rund 150 Milliarden Euro – und eine Aufweichung der Schuldenregeln für die Länder der Europäischen Union. Deutschland wird mit einer angekündigten deutlichen Steigerung seiner Militärausgaben vermutlich einen großen Teil dieses Bewertungsrabatts für sich in Anspruch nehmen. Sollte es der Bundesrepublik entgegen allen Wahrscheinlichkeiten gelingen, die Verteidigungsausgaben in kurzer Zeit auf vier Prozent des deutschen BIPs zu steigern, entspräche dies einem zusätzlichen Finanzierungsbedarf von rund 180 Milliarden Euro pro Jahr. Und zwar nicht „on Top“ auf das Europa-Paket Ursula von der Leyens, sondern innerhalb dessen.
Auch die 500 Milliarden Euro an Sondervermögen des Bundes für die Investitionen zur Sanierung der maroden Infrastruktur in Deutschland sind keine Bazooka. Die Investitionssumme verteilt sich laut Plan auf zehn Jahre, je nach Bedarf und Umsetzungsmöglichkeit. Das ist der Vorteil des Sondervermögens im Vergleich zum Bundeshaushalt, der jedes Jahr neu aufgestellt und verteilt wird. Bleibt die EZB ihrem Kurs treu und senkt die Zinsen demnächst noch weiter ab, könnte sich der Bund in den kommenden Jahren preiswerter verschulden als zuletzt und zugleich über höhere Steuereinnahmen vom Effekt einer anziehenden Konjunktur, die er selbst über seine zusätzlichen Investitionen in Militär und Infrastruktur anstößt, profitieren.
Man sollte sich keine Illusionen machen: Das Gesamtpaket ist natürlich kein finanzpolitisches Perpetuum Mobile, wie manche jetzt hoffen. Aber auch diejenigen, die insbesondere in der vergangenen Woche das Armageddon für europäische Staatsanleihen ausgerufen haben, liegen mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ziemlich daneben. Dafür sorgt nämlich auch ein weiterer Aspekt: Internationale Anleger verlieren angesichts der erratischen Wirtschaftspolitik des Trump-Regimes zunehmend ihr Vertrauen in den US-Dollar. Innerhalb der vergangenen Woche ist der Kurs des US-Dollar von 0,96 auf 0,92 Euro abgerutscht. Aus US-Investorensicht bedeutet das: Wer in europäische Wertpapiere investiert hat, hat allein auf der Währungsseite rund vier Prozent Gewinn gemacht. Bisher freuen sich darüber vor allem Aktien-Anleger. Doch bei solchen Trends setzt sich die Meute erfahrungsgemäß sehr schnell auch am Rentenmarkt in Bewegung. Denn hier sind vier Prozent eine Menge Holz. Und der Rentenmarkt ist um ein Vielfaches mächtiger als der Aktienmarkt.
Fazit: “Whatever it takes“ bedeutet in diesem Fall kein heilloses Überschuldungs-Programm und ist schon gar kein Grund, die nach wie vor solide Bonität der Bundesrepublik kritischer zu bewerten. Im Gegenteil: Experten gehen davon aus, dass Deutschlands Wirtschaft aufgrund der zusätzlichen staatlichen Investitionen bis zum Jahr 2028 zwischen einem und fünf Prozent wachsen könnte. Es bleibt jetzt nur noch zu hoffen, dass die Grünen mitspielen und gemeinsam mit SPD und CDU die Umsetzung des Plans tatsächlich noch im alten Bundestag beschließen. Sonst droht nach der Konstituierung des nächsten Bundestags eine Blockade durch die Putin-Freunde von rechts und links. Das wäre schade. Vorsichtig formuliert.
Interessante Termine in den kommenden Tagen
Am Dienstag stellen Ökonomen in Berlin das neue Jahresheft der Stiftung Familienunternehmen vor. Der Wissenschaftliche Beirat der Stiftung Familienunternehmen äußert sich kurz nach der Bundestagswahl zu wirtschaftlichen Herausforderungen. Auf dem Podium sprechen die Ökonomen Gabriel Felbermayr, Clemens Fuest und Hans-Werner Sinn sowie die Rechtwissenschaftler Udo Di Fabio und Kay Windthorst. Rainer Kirchdörfer, Vorstand der Stiftung, spricht aus der Sicht der Familienunternehmen, die nach wie vor das Rückgrat der der deutschen Wirtschaft bilden. Vermutung: Angesichts der Ereignisse der vergangenen Woche dürften die Herren ihre Vorträge vielleicht noch einmal aktualisiert haben.
Am Mittwoch hält Bundesfinanzminister Jörg Kukies auf der Verbandstagung 2025 des Verbandes kommunaler Unternehmen (VKU) eine Rede. Wird er Zukunftsweisendes verkünden? Falls ja: Könnte dies ein Hinweis darauf sein, dass er auch im nächsten Kabinett Bundesfinanzminister bleibt? Diese Frage ist eigentlich interessanter als die Rede an sich.
Am Donnerstag veröffentlicht das Institut für Weltwirtschaft (IfW) in Kiel seine Konjunkturprognose für Deutschland und die Welt. Das dürfte ebenfalls ein spannender Vortrag werden, bei dem eigentlich eine andere Frage noch interessanter ist: Wann und auf welcher Datenbasis wurde diese Prognose erstellt? Ökonomen haben nämlich derzeit ein ähnliches Problem wie Journalisten: Noch während sie ihre Analysen schreiben, ist schon wieder irgendetwas auf der Welt passiert, was alles Vorhergehende infrage stellt. Und derzeit gilt ohnehin mehr denn je ein beliebtes Bonmot, das Mark Twain, Karl Valentin, Niels Bohr und manchmal auch Winston Churchill zugeschrieben wird: Prognosen sind schwierig – vor allem, wenn es um die Zukunft geht.
Am Freitag findet das 15. Berliner Milchforum statt. Vertreter aus Wirtschaft, Politik, Landwirtschaft und Handel diskutieren über Themen wie Herausforderungen der Milchwirtschaft, Klimatransformation, Tierwohl, Auswirkungen der Blauzungenkrankheit sowie über Richtungsentscheidungen aus der Sicht der Milchindustrie im Rahmen der nationalen und EU-weiten Agrarpolitik. Ach ja, die Milchbauern. Manchmal vergisst man in diesen Tagen, dass es auch noch andere Themen als den möglichen Untergang der Welt gibt. Das Milchforum findet übrigens im Hotel „Titanic Chaussee“ statt.

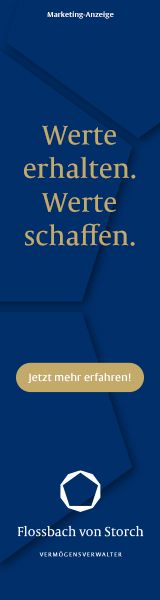
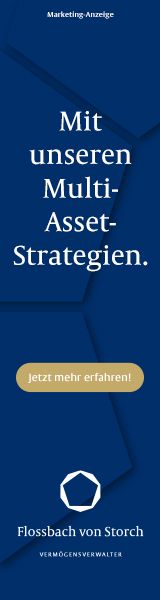




























Diesen Beitrag teilen: