
Fremdwährungen für Skeptiker
In Fremdwährungen investieren? Für viele institutionelle Inves toren in Deutschland kam das bisher nicht infrage. Währungsrisiken passen nicht zu Euro-Verpflichtungen, sagen die einen. Wechselkurse lassen sich nicht erfolgreich aktiv managen, sagen die anderen. Wirklich?!
28.03.2012 | 13:34 Uhr
Typischerweise haben institutionelle Investoren in Deutschland mit ihren Kapitalanlagen langfristige und in Euro lautende Verbindlichkeiten zu erfüllen. In Euro denominierte
langlaufende festverzinsliche Wertpapiere bilden daher meist den Grundstock der Kapitalanlage. Aktien haben, insbesondere nach dem schwankungsreichen vergangenen
Jahrzehnt, nur noch ein geringes Gewicht. Das gilt ebenso für Fremdwährungen.
Globalisierung auch bei Kapitalanlage
Allerdings wird es im Euro-Raum immer schwieriger, langfristige Rentenpapiere mit ausreichender Bonität zu finden. Der Blick der Kapitalanleger muss sich daher zunehmend globaler ausrichten. Für institutionelle Investoren in kleineren Ländern galt das schon immer. In der Schweiz etwa ist der inländische Kapitalmarkt zu klein, um die Anlagebedürfnisse der dortigen Anleger zu sättigen. Investitionen in Fremdwährungen sind deshalb die Regel.
Auch deutsche Anleger müssen ihren Anlagehorizont in diese Richtung erweitern. Eine in Fremdwährung denominierte Anleihe passt immer noch besser zum Verpflichtungsprofil als eine höhere Aktienquote. Es wundert daher nicht, dass laut einer Umfrage von Feri Euro Rating Services unter 152 institutionellen Investoren in Deutschland die Nachfrage nach Währungen steigen wird.
Der Trend ist eindeutig, aber es bleiben Zweifel. Bergen Währungsbewegungen nicht erhebliche Risiken? Und hatte nicht der ehemalige amerikanische Notenbankpräsident
Alan Greenspan einmal gesagt, es gäbe kein Modell zur Vorhersage von Wechselkursen, das dem Werfen einer Münze deutlich überlegen sei?
Alles nur Zufall?
Einer breiten Öffentlichkeit ist der amerikanische Wirtschaftswissenschaftler Kenneth Rogoff vor allem als Historiker von Staatsschuldenkrisen bekannt. Seinen akademischen Ruhm begründete er jedoch vor knapp 30 Jahren mit einer Veröffentlichung zur Prognose von Wechselkursen. Gemeinsam mit seinem Ko-Autor Richard Meese hatte er damals untersucht, ob strukturelle makroökonomische Modelle bessere Währungsprognosen generieren können als ein einfaches Modell, das auf der Annahme rein zufälliger Wechselkursbewegungen basiert. Die Arbeit der beiden Ökonomen zeigte, dass die untersuchten Modelle dazu nicht in der Lage waren.
Ähnlich wie Alan Greenspan zogen vieleaus der Meese-Rogoff-Untersuchung die simple Schlussfolgerung, dass sich Wechselkurse nicht vorhersagen lassen. Die weitergehende Konsequenz wäre dann natürlich, dass ein aktives Management von Währungen keinen Ertrag verspricht und deshalb sinnlos ist. Bis heute ist diese Einschätzung weit verbreitet. Sie beruht allerdings auf einem Missverständnis. Erstens ergab sich das niederschmetternde Ergebnis von Meese und Rogoff nur bei kurz- und mittelfristigen Prognosezeiträumen. Ab einem Horizont von zwei Jahren lieferten die strukturellen Modelle bessere Ergebnisse als das Zufallsmodell. Heute weiß man, dass auch sehr kurzfristige Prognosen möglich sind. Die eigentlichen Schwierigkeiten ergeben sich bei einem Zeithorizont von einem bis zwölf Monaten.
Zweitens gilt die Überlegenheit des Zufallsmodells nur für die damals untersuchten strukturellen Modelle. In den letzten 30 Jahren hat es erhebliche Fortschritte bei der Modellierung von Wechselkursen gegeben. Neuere Studien können zeigen, dass erfolgreiche Wechselkursprognosen möglich sind, wenn moderne theoretische und statistische Konzepte verwendet werden.
Drittens schließlich waren Wechselkurse in gewisser Weise nur ein beliebiges Ziel der Meese-Rogoff-Kritik. Spätere Untersuchungen haben zeigen können, dass beispielsweise auch strukturelle Modelle von Aktienkursen das Zufallsmodell kaum schlagen können. Dass Meese und Rogoff ihre Kritik auf Wechselkurse bezogen, dürfte vor allem daran gelegen haben, dass dort die Datenversorgung extrem gut ist und besonders viele fundamentale Modelle existieren. Falsch ist allerdings die Schlussfolgerung, Wechselkurse wären schlechter als andere Finanzmarktdaten zu prognostizieren.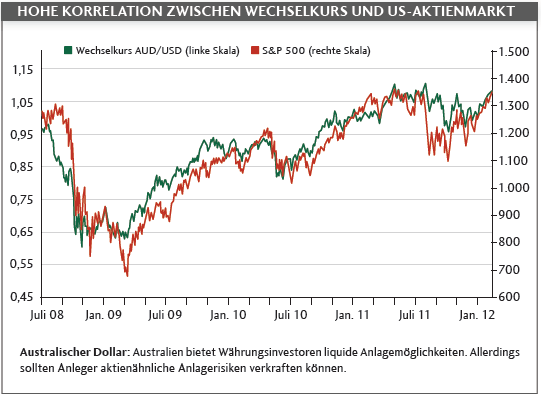
Quellen: FRANKFURT-TRUST, Datastream, Stand: 09. Februar 2012
Strategisches Währungsexposure
Den meisten institutionellen Investoren geht es ohnehin nicht um kurzfristige Prognosen und Handelsstrategien. Der Aufbau von Währungsexposure wird zunehmend als
strategische Position begriffen, die Diversifikation schafft und als langfristige Absicherung gegen Euro-Krisen dient. Der Blick richtet sich dabei vor allem auf liquide Währungen von Ländern, die mit AAA geratet sind.
Außerhalb des Euro-Raums zählen dazu in Europa Dänemark, Großbritannien, Schweiz, Norwegen und Schweden. Im pazifischen Raum sind es Australien und Singapur, in Nordamerika Kanada. Neuseeland zählt seit Ende September letzten Jahres nicht mehr zum Kreis der AAA-Länder, da es bei S&P die Bestnote verloren hat.
Die genannten Länder unterscheiden sich sehr stark hinsichtlich Größe und Liquidität der Kapital- und Devisenmärkte. Dänemark und Schweiz sind extrem kleine und illiquide Märkte. Ihre Währungen sind praktisch an den Euro gekoppelt. Investierbare Kapitalmärkte mit eigenständigen Währungen gibt es außerhalb des Euro-Raums in Europa nur in Großbritannien, Norwegen und Schweden.
Mit einem Zwillingsdefizit in der Leistungsbilanz (-1,9 Prozent des Bruttoinlandsprodukts 2011) und dem Staatshaushalt (-8,6 Prozent des Bruttoinlandsprodukts 2011) steht Großbritannien aber fast so schlecht da wie die USA, die im vergangenen Jahr ihr AAA-Rating verloren. Die hohe Abhängigkeit der britischen Wirtschaft vom Finanzsektor ist ein weiteres Argument, warum dieser Markt kaum als sicherer Hafen dienen kann.
Anders sieht es in Norwegen und Schweden aus, die beide durch „Zwillingsüberschüsse“ glänzen. Schweden hat im vergangenen Jahr im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt sogar einen höheren Leistungsbilanzüberschuss als Deutschland erwirtschaftet, und in Norwegen liegt der staatliche Budgetüberschuss bei sage und
schreibe 14 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Das bedeutet aber auch, dass kein investierbarer Staatsanleihenmarkt für ausländische Investoren in Norwegen existiert. Allerdings gibt es einige AAA-geratete (supranationale) Emittenten, die in norwegischen Kronen emittieren und somit einen Ersatz für Staatsanleihen bieten.
Ähnlich wie Norwegen wird auch Kanada von vielen Investoren wegen seiner Öl- und Gasvorräte geschätzt. Kanada hatte jedoch im vergangenen Jahr ein Leistungsbilanzdefizit im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt, das in etwa dem der USA entsprach. Die staatliche Neuverschuldung war in Kanada zwar nicht ganz so dramatisch wie in den USA. Allerdings übersteigt der prozentuale Anteil der privaten Verschuldung am verfügbaren Haushaltseinkommen inzwischen den der US-Haushalte.
Im pazifischen Raum glänzt Singapur durch hervorragende Fundamentaldaten. Allerdings ist der Markt für ausländische Investoren zu klein. Deutlich größer und liquider ist der australische Markt. Dabei darf aber nicht übersehen werden, dass Australien genau wie Kanada ein Zwillingsdefizit aufweist. Das staatliche Budgetdefizit ist jedoch deutlich kleiner als in Kanada. Für europäische Investoren ist das Zinsniveau äußerst attraktiv: Die Rendite einer zehnjährigen australischen Staatsanleihe liegt bei rund vier Prozent. Zudem hat der australische Dollar gegenüber dem Euro in letzter Zeit deutlich aufgewertet. Wie die Grafik zeigt, ist die Korrelation des Wechselkurses zum US-Aktienmarkt sehr hoch. Wer ungesichert in australische Anleihen investiert, geht daher aktienähnliche Risiken ein.
Aktives Management nötig
Nur wenige Länder bieten Euro-Investoren den optimalen Mix aus hoher Bonität, attraktiven Zinsen und ausreichender Liquidität. Eine Diversifikation des Rentenbestands in Richtung globaler AAA-Länder ist sinnvoll, aber kein Selbstläufer. Länder-, Zins- und Währungsrisiken müssen aktiv gemanagt werden. Wenn dies erfolgreich geschieht, verbessert sich im Rentenbestand nicht nur die durchschnittliche Bonität, sondern auch der Ertrag.
Von Dr. Christoph Kind



Diesen Beitrag teilen: